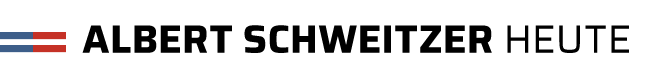Werteorientierung und Personalführung
Referat im Rahmen der Seminarleiterfortbildung
am 23./24.9.2010 Erbacher Hof Mainz
Dr. Gottfried Schüz
Studienseminar GHS Mainz
Vorbetrachtung
„Chefs sind keine Kuschel-, sondern Alphatiere, die sagen, wo es langgeht“ – so lautet eine provozierende Schlagzeile zum Thema Personalführung in der industriellen Welt.1 Mag in vielen Vorstandsetagen unter dem Druck von Wettbewerb und Gewinnsteigerung solch ein Führungsverständnis noch vorherrschen; auf die „Schule“, sprich: Personalführung innerhalb von Bildungseinrichtungen, welcher Art sie auch sei, ist ein solches Leitbild nicht übertragbar. Wer es dennoch tut, hat nicht begriffen, was die Schule von einem Wirtschaftunternehmen grundlegend unterscheidet. Personalführung in der Schule ist von ihren originären Erziehungs- und Bildungszielen bzw. einer rechtverstandenen Erziehungssethik nicht zu trennen.
Wer wissen will, welche Werte für schulische Personalführung maßgebend sind, wird fündig, wenn er sich auf den Ursprungssinn von Schule zurückbesinnt, der sich – wie gesagt – von einem Wirtschaftsunternehmen geradezu kontradiktorisch unterscheidet. Dabei wird deutlich: Werte und Menschenbild gehören zusammen.
Wo könnte dieser Ursprungssinn besser vergegenwärtigt werden als am Bildungsverständnis der Antike. Dort wurde die Leitidee von Schule grundgelegt, der wir auch ihren Namen zu verdanken haben: nämlich Skolae bzw. Schola zu sein, ein Ort der Musse, der Besinnung – ein entlasteter Schonraum des Lehrens und Lernens, der temporären Lebensstätte von Schülern und Lehrern.
Entscheidende Wesenszüge von Schule, wie sie bis zum heutigen Tage wenigstens der Idee nach ungebrochene Geltung haben, lassen sich an dem bekannten römischen Schulrelief2 ablesen; die folgenden vier Wesensmomente möchte ich herausheben:
Die Schule als Ort der Musse gestaltet einen Schonraum …
- der Wahrheits- und Sinnsuche
- der Verständigung und des Verstehens
- der Begegnung auf Augenhöhe
- der Erprobung und Einübung gelingenden Lebens
Wahrheits- und Sinnsuche: Wir sehen in dem Relief eifrig in die Lektüre vertiefte Schüler. Dabei geht es zunächst und zumeist um Erwerb von Kenntnissen, – aber nicht nur. Es fällt nämlich auf, dass der Lehrer selbst keine Schriftrolle in der Hand hält, – es also nicht für nötig befindet, die buchstabengetreue Wiedergabe des Textes zu überprüfen. Warum nicht? – Weil es ihm um mehr geht: Er ist darauf aus, dass seine Schüler die Wahrheit ergründen; dass sie Geist und Sinn des Gelesenen, der gewissermaßen zwischen den Zeilen steht, auf die Spur kommen. Schule ist also im Kern ein Ort der Sinn- und Wahrheitssuche, die den jungen Menschen zur Weltorientierung und Selbstfindung dienen soll.
Verständigung und Verstehen: Zu den bereits intensiv in die Arbeit Vertieften tritt ein offensichtlich zu spät kommender Schüler in der Haltung beklommener Erwartung hinzu und grüßt seinen Lehrer: „Salve magister“ – die geöffnete Hand entschuldigend hochgereckt. Ein Gruß, den der Lehrer unaufgeregt, aber mit betonter Hinwendung und mahnend erhobenem Zeigefinger erwidert. Dass letzteres eher zurückhaltend anmutet (der Zeigefinger ist gekrümmt), lässt doch ein gewisses Verständnis des Magisters für das erwartungswidrige Verhalten seines Zöglings erkennen. In der Schule geht es neben dem Verständigen über Gesagtes, Gelesenes und Gehörtes und dem rechten Verstehen der behandelten Inhalte immer auch um gegenseitige Verständigung in gelebter Gemeinschaft, um das Verstehen von Personen, Handlungen und Situationen; dies verweist zugleich auf den nächsten Aspekt.
Begegnung auf Augenhöhe: Bemerkenswert ist, dass der Magister nicht, wie es auf jüngeren Schuldarstellungen üblich ist, auf erhöhtem Katheder thront, um von dort seine Weisheiten demonstrativ unter die Unwissenden zu streuen. Stattdessen begegnet er ihnen auf Augenhöhe und dies nicht nur im entspannten Lehrgespräch. Auch in einer mehr oder weniger manifesten Konfliktsituation lässt er sich nicht dazu hinreißen, aufzuspringen, um seine ganze Autorität in die Waagschale zu werfen. Er begegnet ihnen vielmehr in der Beziehung von Mensch zu Mensch, mit offenem Visier, in ungebrochener Wertschätzung und ungeteilter Zuwendung.
Erprobung und Einübung gelingenden Lebens: Auch wenn sich das Zuspätkommen des Discipulus als Störfaktor bemerkbar macht, so wird die Integrität der Lehr- und Lerngemeinschaft nicht infrage gestellt. Die sitzenden Schüler lassen sich trotz des Vorfalls von ihrer Lektüre nicht wirklich ablenken, auch wenn sie mit ihrem erhobenen Blick den Ankömmling und die ersichtliche Abwendung ihres Lehrers durchaus bemerken. In dieser spannungsreichen Situation werden in geradezu archaischer Weise Antinomien sichtbar, die immer aufbrechen, wo sich „Schule“ ereignet – zwischen Individualität und Gemeinschaft, Integration und Separation, Selbstentfaltung und Anpassung, Selbstbehauptung und Hingabe. Im Spannungsfeld zwischen diesen Polaritäten muss der Schüler seine innere und äußere Balance finden, ist Schule Hilfe und Geleit für die Einübung gelingenden Lebens.
In unserer Frage, welche Wertorientierungen für eine Personalführung im engeren und weiteren Kontext von Schule und Lehrerausbildung leitend sein können, steht eines außer Frage: Diese Werte und Haltungen müssen im Einklang stehen mit den genannten vier Grundbestimmungen bzw. Wesenszügen von Schule; mehr noch: Personalführung gewinnt ihre eigentliche humane Wertigkeit dadurch, dass sie Grundbedingungen des Menschsseins für ein gelingendes Leben freizusetzen vermag.
Was dies im Blick auf die Grundbedingungen einer humanen Personalführung im Lehrerbildungszusammenhang bedeutet, möchte ich im Folgenden näher beleuchten.
1. Wahrheits- und Sinnsuche
- Kritische Vernunft statt Gedankenlosigkeit
- Erfahrungsoffenheit statt „Totalwissen“
- Visionen/ Ideale statt Resignation
Wenn Schule und Seminararbeit bedeuten, sich zur Wahrheits- und Sinnsuche gemeinsam auf den Weg zu machen bzw. unterwegs zu bleiben, dann kann sich auch die Personalführung nicht von diesem Anspruch ausnehmen. Drei wesentliche Voraussetzungen halte ich in diesem Zusammenhang für unverzichtbar: Das Betätigen kritischer Vernunft, das Bewahren einer Haltung der Erfahrungsoffenheit und das Erhalten von Visionen und Idealen.
Kritische Vernunft statt Gedankenlosigkeit
Personalführung sollte stets darum bemüht sein, den Sinn und die Sinnhaftigkeit anzustrebender Ziele und kollegial zu bewältigender Aufgaben nicht nur transparent zu machen, sondern diese im kollegialen Diskurs konsensuell zu legitimieren. Hierzu muss sie immer auch bereit sein, den Sinn eigenen Sagens und Tuns in seinen Vernunftgründen kritisch zu hinterfragen oder hinterfragen zu lassen. Vernunft ist mehr als bloß verstandesmäßiges, instrumentelltechnisches Erfassen, Organisieren oder Steuern von Vorgängen. Die seit Kant übliche Unterscheidung von „Verstand“ und „Vernunft“ ist auch hier von grundlegender Bedeutung. Der „Verstand“ ist ein funktionales Vermögen, das logischen Gesetzmäßigkeiten folgt und die möglichst zweckmäßige Umsetzung von Zielen verfolgt, ohne aber diese Ziele selbst legitimieren zu können. Der Verstand ist lediglich „Bauarbeiter“, nicht „Architekt“.
Ganz anders die Vernunft: Erst sie entwirft den Horizont der Handlungsmöglichkeiten und vermag jenseits aller Zweckmäßigkeitserwägungen Bedeutsamkeiten erfahrbar zu machen und Handlungsalternativen auf ihre lebenstragende Sinnhaftigkeit hin zu bedenken. Erst durch sie sind wir fähig und bereit, Gewohntes und Vertrautes kritisch in Frage zu stellen, ausgetretene Pfade zu verlassen und nach neuen Ufern Ausschau zu halten.
Daher darf sich Personalführung nicht in administrativen Handlungsstrategien, bloßem Organisieren und Regulieren erschöpfen, so notwendig dies zur zweckmäßigen Alltagsbewältigung auch ist. Personalführung muss sich die lediglich dienende Funktion des Organisierens, Evaluierens und Regulierens bewusst halten und immer auch das (selbst-)kritische Nach- und Mitdenken darüber fordern und fördern, was den grundlegenden humanen Sinn des gemeinsamen Tuns und Lassens trägt.
Zudem ist ein weiterer Aspekt der „kritischen Vernunft“ für den vorliegenden Zusammenhang wichtig, auf den Otto Friedrich Bollnow aufmerksam gemacht hat: „Vernunft“ wirkt auf Überwindung und Ausgleich von Gegensätzen hin; sie schafft in Anbetracht aufbrechender Affekte und emotional bedingter Verwerfungen im kollegialen Bezug die Voraussetzungen für ein „vernünftiges“, d.h. verträgliches und friedliches Miteinander. Die Vernunft ist Bollnow zufolge das „Prinzip des Maßes“, das der Maßlosigkeit der Leidenschaften und Affekte mäßigend entgegenwirkt; sie ist „gegenüber der Unmenschlichkeit der Leidenschaft der Sitz des eigentlich Humanen im Menschen“.3
Schließlich ist der von Kant grundgelegte erkenntniskritische Aspekt von „Vernunft“ zu beachten, der zugleich „ethisch“ hoch bedeutsam ist: Kant hat in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ für alle Zeiten dargelegt, dass unser Erkenntnisvermögen unhintergehbar auf die „Welt der Erscheinungen“ eingegrenzt ist; das „Ding an sich“ ist unerkennbar. Wir alle Leben in einer „gedeuteten“ und damit eben auch missdeutbaren Welt der Erscheinungen, die „Wirklichkeit an sich“ ist für uns unerkennbar!
Der Konstruktivismus hat den erkenntniskritischen Ansatz Kants dahingehend radikalisiert, dass innerhalb der uns allen gemeinsamen, von unserem „Denkapparat“ hervorgebrachten Erscheinungswelt jedes Individuum seine eigene Binnenwelt konstruiert. Somit ist von einer Pluralität an Erfahrungs- und Deutungsweisen von Welt auszugehen. „Kritisch“ ist die Vernunft in diesem Betracht insofern, als wir uns mit und seit Kant der Grenzen der eigenen Erkenntnismöglichkeiten bewusst werden. Wir müssen uns von der naiven Vorstellung verabschieden, dass die je eigene Weltsicht ein untrügliches Abziehbild einer von uns unabhängigen Wirklichkeit wäre.
An die Stelle eines Alleinvertretungsanspruchs, das „wahre“ Bild der Wirklichkeit zu besitzen, sollte das konkurrierende Nebeneinander je eigener Wahrheiten und Weltsichten treten. Daher bleibt nur eines: In der Vielfalt nebeneinander oder auch gegeneinander stehender Weltdeutungen und Sinnentwürfe und Sichtweisen auf Verständigung mit dem Anderen auszugehen, eigene subjektive Bedingtheiten wahrzunehmen und im Medium der Gemeinsamkeit tragfähige Handlungsentwürfe diskursiv zu finden. Auch deshalb ist es geboten, auf irrationales Machtgehabe zur Durchsetzung eigener Positionen zu verzichten, sich zu mäßigen, d.h. sich in Selbstdisziplin zu üben und auf das Eintracht stiftende Prinzip der mäßigenden Vernunft zu hören.
Erfahrungsoffenheit statt „Totalwissen“
Ein Zeitungscartoon zu einem Mitarbeitergespräch erhielt folgenden Kommentar: „Ich glaube, Sie haben Talent. Und ich höre nicht auf, danach zu suchen, bis ich es gefunden habe!“4
Dies klingt zunächst recht positiv: Der Vorgesetzte fokussiert sich nicht auf Schwächen oder Defizite des Mitarbeiters und er verzichtet auch auf mahnende Appelle. Er scheint nach dieser Aussage offen für die verborgenen Fähigkeiten des Mitarbeiters; er ist offensichtlich ressourcenorientiert statt defizitorientiert. Bei näherem Hinsehen hat diese Aussage etwas Problematisches: Ihr liegt die unausgesprochene Voraussetzung zugrunde, dass der Andere in seinem Sosein zwar noch ein Buch mit sieben Siegeln aber ein ausforschbares und dadurch letztlich ergründbares und lesbares Buch darstelle. Sein Blick auf den Mitarbeiter scheint mehr durch das Raster der eigenen Erwartungen bestimmt als durch die unauslotbaren Möglichkeiten, die in diesem schlummern.
Der Philosoph Karl Jaspers schrieb, dass der Mensch immer mehr ist als man weiß oder auch nur wissen kann. Dies schließt unmittelbar an die zuvor angesprochene erkenntniskritische Betrachtung an: Unser Wissen von der Welt und erst recht vom Menschen, wer auch immer er sei, bleibt immer nur partikular – ein „Totalwissen“ bleibt aus. Darum ist höchste Zurückhaltung in der Deutung oder Wertung von Verhaltensweisen und von vermeintlich zugrunde liegenden Eigenschaften oder Wesenseigentümlichkeiten von Mitmenschen angezeigt. Schon Aristoteles bezeichnete den Menschen als einen „Mikrokosmos“, eine Welt im Kleinen; d.h. jeder Mensch ist letztlich ein unerforschliches Universum. Das Wissen vom Anderen, so differenziert und valide es auch sein mag, bleibt immer fragmentarisch.
Nun könnte man diese Tatsache als unbestreitbar auf sich beruhen lassen und sich stattdessen genügsam auf seine handfesten „Erfahrungen“ stützen, die man mit seinen Mitarbeitern gemacht hat und täglich neu macht. Aber was hat es mit den sog. Erfahrungen auf sich?
Scheiden sich nicht häufig gerade an den unterschiedlich gemachten Erfahrungen die schulischen Geister und ist es nicht gerade der praxiserprobte ältere Kollege, der den Ideen und dem Tatendrang des noch unerfahrenen Berufsanfängers seine langjährigen Erfahrungen mahnend entgegenhält: „Ach davon rate ich Ihnen lieber ab. Das habe ich am Anfang auch versucht; das läuft nicht. Sie werden schon noch Ihre Erfahrungen machen“.
Bedenkt man gerade die letztgenannte Position, so scheint es nicht selten, dass gar mancher wohlmeinende Berater unter Berufung auf seine „Erfahrung“ geradezu verhindert, dass der andere eigene und möglicherweise andere Erfahrungen macht.
Etwas anders, aber in dieselbe Richtung gehend und schärfer noch, hat es schon Johann Friedrich Herbart formuliert:
„Ein neunzigjähriger Dorfschulmeister hat die Erfahrung seines neunzigjährigen Schlendrians; er hat das Gefühl seiner langen Mühe; aber hat er auch die Kritik seiner Leistungen und seiner Methode?“5
Ein merkwürdiger Widerspruch tut sich hier im Phänomen der Erfahrung auf. Auf der einen Seite gibt es offensichtlich die Erfahrung jener, die sich gegen alles zunächst Unverständliche, Abweichende oder Fremde abschirmen und verschließen. Sie nehmen deshalb nur das wahr, was der Bestätigung des eigenen Standpunktes dient und sind nicht mehr bereit oder in der Lage, Kritik von außen anzunehmen oder gar sich selbst einer Kritik zu unterziehen.
Auf der anderen Seite gibt es die Erfahrung dessen, der die lebendige Auseinandersetzung mit Hindernissen und Widrigkeiten nicht scheut, vielmehr in eine aktive Suchbewegung nach weiterführenden Wegen und Lösungen eintritt und zu neuen Ufern vorstößt. Dies hatte wohl auch Herbart im Auge wenn er weiter schreibt: „… so kann es geschehen, dass ein grauer Schulmann noch am Ende seiner Tage, … ja Reihen von Generationen von Lehrern, die immer in gleichen oder in wenig abweichenden Geleisen neben- und hintereinander fortgehn, nichts von dem ahnen, was ein junger Anfänger in der ersten Stunde durch einen glücklichen Wurf, durch ein richtig berechnetes Experiment sogleich in voller Bestimmtheit erfährt“.
Erfahrung ist ihrem Wesen nach ambivalent und doppelgesichtig. In jeder einmal gemachten Erfahrung liegt die Gefahr einer bleibenden Festlegung, hinter der wir uns verschanzen und aufgrund derer wir uns gegen alles Störende und Neue abkapseln.
Die Erfahrung birgt auf der anderen Seite aber auch die Chance des Aufbruchs, der Öffnung gegenüber dem Ungewohnten und Neuen. Eine solche Erfahrung ist niemals abgeschlossen, sondern bildet den entscheidenden Motor für eine produktive Erneuerung des Lebens und überhaupt jeglicher schöpferischer Entwicklung.
Angesichts der Vielschichtigkeit und Vieldeutigkeit des Menschen ist es notwendig, Offenheit zu wahren, sich vor abschließenden, festschreibenden Typisierungen im Blick auf den Mitmenschen zu hüten. Jeder Form der Einschätzung und Zuweisung von Eigenschaften und Merkmalsbündeln liegen Abstraktionen, Reduktionen und Projektionen zugrunde, die es immer wieder zu durchbrechen gilt und offen zu halten sind für die Unergründlichkeit des Menschen, ja des Lebens überhaupt. Daher korrespondiert mit der Erfahrungsoffenheit des Leiters immer auch die Wesensoffenheit des Mitarbeiters und die des eigenen Selbst. Wesensoffenheit, nicht nur in dem Sinne, dass er sich offen halten muss für die Unergründlichkeit seines Wesens, sondern dass dieser in seinem Wesen selbst nicht festgelegt, sondern gestaltungsoffen und wandlungsfähig ist.
Visionen/ Ideale statt Resignation
Albert Schweitzer schreibt in seinen Jugenderinnerungen:
„Wir alle müssen darauf vorbereitet sein, dass das Leben uns den Glauben an das Gute und Wahre und die Begeisterung dafür nehmen will. Aber wir brauchen sie ihm nicht preiszugeben. Dass die Ideale, wenn sie sich mit der Wirklichkeit auseinandersetzen, gewöhnlich von den Tatsachen erdrückt werden, bedeutet nicht, dass sie von vornherein vor den Tatsachen zu kapitulieren haben, sondern nur, dass unsere Ideale nicht stark genug sind. Nicht stark genug sind sie, weil sie nicht rein und stark und stetig genug in uns sind.“6
Mit dem oben beschriebenen konservativen Erfahrungsbegriff hängt es zusammen, dass wir dazu neigen, real gegebene Verhältnisse als Normalität hinzunehmen und uns mit vermeintlich Unabänderlichem zu arrangieren. Allzu leicht drohen wir der Suggestivkraft einer „Normativität des Faktischen“ zu unterliegen und dabei gerade auch Problematisches und Widersprüchliches als unabänderlichen Sachzwang, als hinzunehmende Naturgegebenheit oder Strukturbedingtheit umzudeuten. Im personalen Bereich sind es oft Unvereinbarkeiten im Konfliktfeld des „Menschlich-Allzumenschlichen“, die negative Erwartungshorizonte setzen und einen in Sackgassen geraten lassen, aus denen Viele nicht mehr herauskommen. In solchen Situationen fällt es schwer, den nötigen Mut und die Kraft aufzuwenden, gewohnte Verhaltensmuster und verfestigte Beziehungsstrukturen aufzubrechen und zum Besseren hin nachhaltig zu verändern. Es scheint vorderhand leichter, in solchen Fällen in die innere Emigration zu gehen oder einen gewissen Leidensdruck einfach auszuhalten als aktiv an die Bearbeitung problematischer Beziehungsverhältnisse heranzugehen. Man müsste ja Konflikte und unerfreuliche Auseinandersetzungen riskieren oder selbstkritisch an die eigene „Substanz“ gehen, d.h. die eigene Haltung im Verhältnis zu Anderen infrage stellen und gegebenenfalls verändern.
Entsprechendes gilt für die oft fehlende Bereitschaft, sich aus dem jeweiligen beruflichen Aufgabenbereich heraus für neue Herausforderungen zu öffnen und langjährig Vertrautes und scheinbar Bewährtes auf den Prüfstand zu stellen. Gerade in den Studienseminaren stehen wir zur Zeit in einer Umbruchsituation, die es erfordert, eingefahrene Wege zu verlassen bzw. neue Wege zu gehen, die erst entstehen, indem sie gegangen werden. Dabei ist ein Übereifer im Veränderungswillen, durch den auch Bewährtes auf der Strecke bleibt, nicht weniger problematisch als ein Verharren in erstarrten Strukturen. Vor allem Letzteres, das gedankenlose Dahinleben in sich überlebt habenden Gewohnheiten bekommt vielfach durch die Berufung auf angeblich hinderliche Verhältnisse eine fatale Legitimation, die in Resignation endet. Darum ist eine stets erneute und erneuernde Besinnung auf Ideen und Ideale, die sich von den schlechten Verhältnissen vor Ort nicht korrumpieren lassen, buchstäblich lebens-notwendig, weil nur sie die Not, in der das Leben oft festfährt, zum Besseren hin zu wenden vermag.
Kant nannte die Vernunft das „Vermögen der regulativen Ideen“, an denen sich unser Handeln orientiert. Gerade weil sie die Realität übersteigen, können sie Leitstern sein für das Schaffen neuer und besserer Realitäten.
Albert Schweitzer erblickte in der Ehrfurcht vor dem Leben „das Ideal der Ideale“, ein Art Eichmaß, an dem die Entscheidungen und Handlungsziele im Kleinen auf ihre Kompatibilität mit dem größeren Ganzen geprüft werden können. Wem ein solches leitendes Ideal fehlt, verliert sich leicht im Labyrinth der Alltäglichkeit. Ohne den Kompass einer die faktischen Gegebenheiten übersteigen den Vision besteht die Gefahr, die Ankunft in Sackgassen mit der eigentlichen Heimkunft im „gelobten Land“ einer besseren Welt zu verwechseln.
Darum muss neben der bloßen Erfüllung der alltäglichen Pflichten immer auch ein Reflexionsraum für Ideen/ Ideale und Visionen im Blick auf ein „Anderswo“ und „Anderswie“ offengehalten werden, in einem Studienseminar sicher noch mehr als in anderen Einrichtungen.
Eine solche Reflexion ist immer auf eine Verstehens- und Verständigungsgemeinschaft mit dem Anderen verwiesen, auf deren Bedingungen ich im Folgenden eingehe.
2. Verstehen und Verständigung
- Wahrhaftigkeit statt Verstellunng
- „Wille zum Zweifeln – Wille zum Horchen“ statt Einwegkommunikation
- Humor statt Ironie
- Wahrhaftigkeit statt Verstellung
Im privaten wie im beruflichen Lebenszusammenhang sind die verschiedenen Formen der Unwahrhaftigkeit in all ihren Abstufungen vom bloßen „Schönen“, d.h. des Darstellens der eigenen Person oder Leistung im möglichst positiven Licht, über die Vorspiegelung falscher Tatsachen im Sinne des (Vor- Täuschens) bis hin zur Lüge moralisch fragwürdig bis geächtet. Dennoch glaubt „jeder“, sich gelegentlich aus „berechtigten“ Gründen ihrer bedienen zu dürfen; vor allem, wenn man das Risiko, dass man durchschaut oder ertappt wird, gering veranschlagt. Im beruflichen Kontext spielen solche Strategien schon unter dem Druck der Existenzsicherung, des Strebens nach Selbstbehauptung oder beruflichem Fortkommen eine ungleich größere Rolle. Aber kaum einer denkt über die ethische Problematik solcher vermeintlichen Überlebensstrategien nach.
Mangelnde Wahrhaftigkeit bildet im kollegialen Beziehungsfeld zweifellos eine der Hauptursachen von Konflikten und persönlichen Zerwürfnissen, die letztlich zulasten aller gehen. Was sich als Augenblicksvorteil erweist, führt auf längere Sicht nicht selten zu umso härteren Rückschlägen. Wer in der Verantwortung der Personalführung steht, sollte sich mit Albert Schweitzer bewusst halten, dass er bzw. sie stets „Leben ist, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“.7 Er muss sich über sein Verhältnis zu den ihn täglich umgebenden Mitarbeitern ins Klare und damit auch „ins Reine“ kommen. Die Besinnung auf mein Verhältnis zum Anderen, in der ich mir der (gleich-)berechtigten Interessen des Mitarbeiters bewusst werde und diese in meinem Entscheiden und Handeln „wahrhaftig“ in Betracht ziehe, kann das Verhältnis zu mir selbst nicht ausgeklammert bleiben. Wahrhaftigkeit ist für Albert Schweitzer sogar primär eine Frage der Selbstbezüglichkeit. Die
Wahrhaftigkeit macht den Wesenskern der „Selbstvervollkommnung“ aus, die zusammen mit der „Hingebung“ die beiden zusammengehörigen Brennpunkte der von Schweitzer postulierten „vollständigen Ethik“ bilden. 8 Wahrhaftigkeit im Umgang mit sich selbst weist der „Selbstvervollkommnung“ den Weg, die das Gegenteil einer „egoistischen Selbstbehauptung“ ist. Jene bedeutet vielmehr, sich freizumachen von Hinterlist, Täuschung und Verstellung, von Überheblichkeit, Lieblosigkeit und Gehässigkeit.
Wer führen will, muss vor allem anderen mit sich selbst ins Reine kommen, nämlich sein Verhältnis zum Anderen immer auch im Spiegel der Wahrhaftigkeit gegenüber sich selbst reflektieren. Das heißt, nichts vom Mitarbeiter zu verlangen, was man nicht selbst vorlebt bzw. einzulösen bereit ist. „Echtheit“ und „Glaubwürdigkeit“ stehen zum wahrhaftigen Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten Pate. Wo diese ausbleiben, sind gegenseitigem Ausspielen, Intrigen und Mobbing Tür und Tor geöffnet.
Für ein Führen-können gewinnt die eigentliche Legitimation nicht derjenige, der kraft Amtes botmäßiges Verhalten der Mitarbeiter einfordert, sondern der an der eigenen Läuterung arbeitet.
„Wille zum Zweifeln – Wille zum Horchen“ statt Einwegkommunikation
Mit der Wahrhaftigkeit ist ein Wert angesprochen, der alle wirkliche zwischenmenschliche Verständigung und echtes Verstehen allererst möglich macht. Damit ist freilich nicht garantiert, dass kollegiale Verständigung und Verstehen auch gelingen. Ein umfassendes kollegiales Verstehen im Medium vernünftiger Verständigung erschöpft sich nicht im bloßen Informationsaustausch oder gar in leitungszentrierter Instruktion. Jenes greift tiefer in dem, was der Philosoph Paul Ricoer als „doppelte Hermeneutik“ beschrieben hat: im „Willen zum Zweifeln“ und im „Willen zum Horchen“. 9
Eine unerlässliche Dimension des Verstehens im Bewältigen der täglichen Aufgaben liegt im „Willen zum Zweifeln“: Sachverhalte und Argumente auf ihre Stichhaltigkeit kritisch unterscheidend zu analysieren und auf ihre Stimmigkeit und Tragfähigkeit zu prüfen. Darüber hinaus ist der Wille zum Zweifel nach Ricoer auch ein „Kampf gegen die Masken“, d.h. Verstellungen, Täuschungen oder versteckte Motive und unlautere Absichten zu erkennen und zu entlarven. Dieses ist das angestammte Betätigungsfeld einer Ideologiekritik. Aber diese Weise des Verstehens ist nicht alles: Ich hatte (Seminar-)Kollegen erlebt, deren Taktik des Zweifels zur Obsession geworden war; die in allem, was „von oben“ (sprich: Schulbehörden) kam, Auswüchse fragwürdiger Machtausübung witterten oder in dem, was „von unten“ (sprich: Anwärtern) kam, als Bestätigung systembedingter Leiderfahrungen. Eine solche Verabsolutierung des kritischen Blicks auf alles, auch wenn man edle Ziele zu verfolgen vorgibt, ist ausgesprochen inhuman.
Der Wille zum Zweifel muss notwendig ergänzt werden durch den „Willen zum Horchen“ – ein möglichst vorurteilsfreies, unbefangenes Aufnehmen des Sich- Darbietenden in seinem Eigenwesen, in letzter Konsequenz als selbstvergessene Hingabe an offenbar werdende Gehalte. Das bedeutet, Dinge, Verhältnisse und Menschen nicht auf den Augenschein zu reduzieren, sondern in ihrer Vielschichtigkeit sehen zu lernen gemäß dem Zen-Buddhistischen Spruch, dass man lernen muss, „mit den Augen zu hören“:
Im aufmerksamen, gesammelten Hören übersteigen wir den gegenstandsgebundenen Weltbezug hin zur ursprünglichen Offenheit eines reinen Anschauungsraums. In ihm vollzieht sich ein Transzendieren in eine höhere Welt bzw. tiefere Wirklichkeitsdimension im ursprünglichen Sinne des Wortes. Im Zen- Spruch, dass wir lernen müssen, mit den Augen zu hören, ist daher eine Mahnung, ja Forderung ausgesprochen. Er fordert von uns eine radikale Abkehr von einer vordergründigen Wirklichkeitssicht, nämlich von unserer ich-bezogenen, vereinnahmenden Welteinstellung abzusehen, uns von den alltäglichen Voreingenommenheiten und Erwartungen zu lösen und den Blick frei zu machen für die Fülle und Eigentümlichkeiten der Lebewesen und Dinge. 10
Hier ist neben dem Verstand das „Herz“ angesprochen, so wie es Antoine de St.-Exupéry den „Kleinen Prinzen“ sagen lässt: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“11
In Anwendung auf das kollegiale Miteinander hat dieser Zusammenhang eine nicht zu überschätzende Bedeutung: Bei aller notwendigen kritisch-rationalen Einstellung und strategischen Ausrichtung des täglichen professionellen Handelns ist es, wenn der „Mensch“ ins Spiel kommt, immer wieder erforderlich, die kritische Distanz aufzugeben, um in die Situation bzw. das unverwechselbare Eigenwesen des Anderen im besagten Sinne hineinzuhören. Dies schafft menschliche Nähe, Verständnis und Achtsamkeit für die Existenz des Anderen, wo sonst nur nüchterne Funktionalität herrscht. Für ein gedeihliches Seminarklima ist dies unerlässlich.
Humor statt Ironie
Wer kennt sie nicht – Kollegen, die stets einen lockeren Spruch oder Witz „drauf“ haben, die aber schon bei nächster Gelegenheit, wenn es um die Durchsetzung eigener Interessen geht, keinen „Spaß“ mehr verstehen. Solches wirkt sich auf das kollegiale Verhältnis ebenso negativ aus wie ironische oder gar spöttische Bemerkungen, die, geschickt platziert, manchen Lacher provozieren, die aber letztlich immer auch auf Kosten Dritter gehen. Ein nachhaltig positives Seminarklima erwächst aus einem anderen Stimmungsboden: einer heiteren Grundstimmung, in der Arbeitsfreude und Humor keine aufgesetzten Ausnahmeerscheinungen sind, sondern die Atmosphäre des täglichen Miteinanders prägen und tragen.
Ein Arbeitszusammenhang, der sich ausschließlich als durchorganisiertes System versteht, in dem fest umrissene Zuständigkeiten, Funktionen und hierarchische Strukturen vorherrschend sind, lässt für Humor wenig Raum. Personalführung in solchem Kontext wird hauptsächlich darüber wachen, dass Pläne fristgerecht umgesetzt, Formalitäten eingehalten und Zielvorgaben bedient werden, kurz: dass der Betrieb „funktioniert“. Dies wird vor allem dann problematisch, wenn sich Organisation und Regulation als Selbstzweck erweisen und die beteiligten Menschen nur als Mittel und Erfüllungsgehilfen wahrgenommen werden.
Natürlich muss die Seminarleitung darauf achten, dass die einzelnen Mitarbeiter und das Kollegium insgesamt ihre Aufgaben verantwortlich wahrnehmen. Allerdings dürfen Wohl und Lebensrechte der Beteiligten niemals sog. Sachzwängen untergeordnet werden.
Vor allem „Humor“ verleiht aller Sachlichkeit ein menschliches Antlitz. Bei allem Eifer oder Begeisterung für die Sache, die leicht in Verbissenheit oder Perfektionismus ausarten können, sorgt Humor für innere Distanz zu menschlichen Zwecksetzungen und nimmt diesen ihren Ausschließlichkeitsanspruch. Humor bewahrt vor Fanatismus, Intoleranz und Selbstgerechtigkeit. Humor vermag auftretende Spannungen und Gegensätze zu überbrücken und auch harten Auseinandersetzungen die Spitze zu nehmen und versöhnlich zu stimmen. Humor ist das unerlässliche Salz in der Seminarsuppe, der Tropfen Öl im manchmal stockenden Getriebe, der Reibungsverluste vermeidet, das Lebenselexier auch einer Seminarkultur, die mehr ist als bloßer Ausbildungsbetrieb. Im zwischenmenschlichen Verhältnis hebt Humor hierarchische Beziehungsstrukturen auf und eröffnet Raum für eine Begegnung von Mensch zu Mensch, wie es im Folgenden näher zu betrachten ist.
3. Begegnung auf Augenhöhe
- Beziehung statt Funktion
- Vertrauen statt Kontrolle
- „Grenzenlose“ Verantwortung statt Rollenfixierung
- Gelassenheit statt Nachlässigkeit
Beziehung statt Funktion
Wir leben von Haus aus in der Welt der Erfahrungen, der Zwecksetzungen, des Gebrauchens und Nutzens. Wir leben, wie es Martin Buber ausdrückt, im Ich- Es-Verhältnis. Dies ist, wie schon angedeutet, sicherlich unerlässliche Voraussetzung für ein Funktionieren mehr oder weniger komplexer Organisationen. Ohne diese „Es-Welt“ könnte der Mensch nicht leben; aber wer allein in ihr lebt, verfehlt sein eigentliches Menschsein.12
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“13, so lautet die Grundthese Bubers. In ihr wird der Andere nicht als „Es“, d.h. als „Sache“ oder „Gegenstand“ wahrgenommen, sondern als „Du“. Die eigentliche Begegnung von Ich und Du ist ein Verhältnis der Beziehung, der Unmittelbarkeit, der Gegenseitigkeit und der Bejahung.
„Beziehung ist Gegenseitigkeit. Mein Du wirkt an mir, wie ich an ihm wirke. Unsre Schüler bilden uns, unsre Werke bauen uns auf … Wie werden wir von Kindern, wie von Tieren erzogen! Unerforschlich einbegriffen leben wir in der strömenden Allgegenseitigkeit“.14
Im pädagogischen Bezug ist es uns bewusst: Die Schülerinnen und Schüler sitzen der Lehrerin, dem Lehrer nicht als unbezügliche Wesen gegenüber, die auch ohne sie oder ihn sind wie sie sind. Vielmehr ist ihr Sosein nur aus dem Bezugsverhältnis von An-spruch und Entsprechung begreiflich. Die Weise, wie die Lehrperson Kinder anspricht: verstehend, wertschätzend, fordernd und fördernd, so treten sie mit ihr in Resonanz, werden ihre Fähigkeiten und Kräfte mobilisiert und entwickeln sie ihr eigenes Selbstverständnis. Dass dieses Verhältnis sich nicht von vorneherein intentional, d.h. nach Willen und Erwartung der Lehrkraft gestaltet, liegt in eben der „Natur“ des In-Beziehung-seins. Wir sehen uns bei allem professionellen Gestalten-können des pädagogischen Verhältnisses grundsätzlich in einen Horizont der Unverfügbarkeit gestellt, in dem wir der Unverwechselbarkeit, Unvertretbarkeit und Freiheit des Anderen gewahr werden.
Dieser Zusammenhang gilt nicht weniger für das kollegiale Verhältnis, das neben der unerlässlichen sachlichen Bezugsebene (Ich-Es) immer von der personalen Bezugsebene (Ich-Du) überformt sein sollte, durch das Vorgesetzte und Mitarbeiter sich unbeschadet ihrer Position und Funktion „auf Augenhöhe“ begegnen.
Anders gesagt: Unser Nutz- und Machtwille, so lebensnotwendig er sein mag, darf den menschlichen Beziehungswillen niemals übermächtigen. „Beziehung“ muss das eigentlich Tragende bleiben. Sie bringt uns zu dem Anderen in ein ethisch-geistiges Verhältnis. Mitarbeiter sind nicht in erster Linie als Rollen- und Funktionsträger zu sehen, die nach bestimmten Zwecksetzungen zu „funktionieren“ haben. Wir müssen uns offenhalten für ihre Gegen-wart, für das gegenwartende und gegenwährende ihres Menschwesens, mit dem wir, ob wir wollen oder nicht, von einem unverfügbaren Lebensganzen umgriffen und getragen sind. Mit einer Wendung Immanuel Kants gesagt: Der Mensch sei in seiner Person niemals bloß Mittel, sondern „Zweck an sich“.
Vertrauen statt Kontrolle
Wer mit dem Personsein des Anderen und einem In-Beziehung-sein mit dem Anderen ernst macht, muss mit dessen Selbstsein aus Freiheit nicht nur rechnen, sondern dieses a priori (sprich: vor bzw. ungeachtet aller Erfahrung) voraussetzen.
Der misstrauische Vorgesetzte beargwöhnt seine Mitarbeiter, begegnet ihnen mit Missmut und ist permanent in Hab-Acht-Stellung, um sie zu überwachen und zu kontrollieren. Jener muss sich nicht wundern, dass diese dann genau das tun, was er zu verhindern sucht: nämlich über die zu eng gezogenen Stränge zu schlagen.
Ganz anders der Vertrauende; er gewährt dem Anderen einen Raum unkontrollierter Freiheit, in dem dieser Eigenverantwortung entfalten und Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten entwickeln kann. Auf denjenigen, dem Vertrauen entgegengebracht wird, bleibt eine solche Haltung nicht ohne Wirkung. Otto Friedrich Bollnow spricht von der „umschaffenden Kraft“ des Vertrauens. Wem Vertrauen entgegengebracht wird, der erfährt eine eigentümliche innere Nötigung, dem in ihn gesetzten Vertrauen zu entsprechen.15 Er sieht sich angespornt, das in ihn gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen.
In dem Maße, wie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vertrauen entgegengebracht wird, kann auch ihr Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten wachsen!
Freilich kann das Vertrauen, das man in einen Kollegen oder Mitarbeiter gesetzt hat, auch enttäuscht werden. Dies darf jedoch nicht zu der fatalen Konsequenz führen, ihm hinfort mit Misstrauen und Skepsis zu begegnen in allem, was er sagt und tut. Vertrauen bleibt immer ein „Wagnis“, zu dem sich jeder immer wieder aufschwingen muss, weil nur so ein Miteinander im Geist der Menschlichkeit erhalten bleiben kann.
Albert Schweitzer erkannte die fundamentale Bedeutung des Vertrauens nicht nur für die Erziehung, sondern für jegliche Beziehung zwischen Menschen und Völkern. Nur auf dem Boden gegenseitigen „Vertrauens“ kann sich wahre „Menschlichkeit“ entwickeln wie auch umgekehrt „Vertrauenswürdigkeit“ erst in einer Kultur gedeihen kann, die durch das „Humanitätsideal“ getragen ist.
„Grenzenlose Verantwortung“ statt Rollenfixierung
Wer ein „Unternehmen“ wie Schule oder Studienseminar nach dem Modell eines Uhrwerkes zu führen versucht, in dem jedes Rädchen an seinem Platz die ihm zugewiesene Funktion erfüllt, mag Organisationsentwickler, Systemtheoretiker oder Manager beeindrucken, geht aber an der Wirklichkeit und Aufgabe dieser Einrichtungen vorbei.
Selbstredend geht es ohne Rollendifferenzierung und Aufteilung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten unter den Mitarbeitern auch nicht, sonst ist „organisiertes Chaos“ die notwendige Folge. Arbeitsteilung ist schon aus Gründen der Entlastung notwendig und schafft die Voraussetzung dafür, in einem überschaubaren Aufgabenbereich seine jeweilige Teilverantwortung auch voll erfüllen zu können. Aber auch hier wäre der Umkehrschluss verfehlt: Mitarbeiter auf Rollen und Zuständigkeiten einzuengen oder zu fixieren, und ihnen den Blick über den eigenen Tellerrand zu verwehren nach dem Motto: „Kümmern Sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten, damit haben Sie genug zu tun“. Teilfunktionen und Teilverantwortlichkeiten können vom einzelnen Mitarbeiter nur dann sinnvoll und zieltragend wahrgenommen werden, wenn sie konstruktiv zur Erfüllung der Gesamtaufgabe beitragen. Umgekehrt muss sich in der Perspektive eines gelingenden Ganzen die jeweilige Teilverantwortung auch als notwendig und tragend erweisen.
Wenn es um die Verwirklichung des Sinnganzen eines gelingenden Lebens geht, wie es ein Studienseminar anstrebt, dann ist immer auch eine übergreifende Verantwortung jedes Einzelnen für das Ganze anhängig. Jede Gesamtverantwortung ohne produktive Wahrnehmung von Teilfunktionen bleibt leer und jede Teilverantwortung ohne Blick auf das Ganze ist blind. Daher ist von Leitungen wie Mitarbeitern eine doppelte Offenheit gefordert, die an eine grenzüberschreitende Verantwortung appelliert: Sowohl im Sinne des produktiven Mitdenkens und Mitgestaltens für ein gelingendes Ganzes als auch im Hinblick auf ein kritisches Reflektieren und Revidieren gesetzter Teilaufgaben und Ziele. Jede von Menschen für Menschen wahrgenommene Verantwortung ist letztlich von einem Hof der Unbestimmtheit und Unbegrenztheit umgeben, der über ihren institutionell definierten Radius hinausreicht. Im Blick auf Schweitzers Grundsatz, dass ich „Leben“ – sprich: Mitarbeiter – bin, der leben will, inmitten von Mitarbeitern, die auch leben wollen, ist die Verantwortung ihrem Wesen nach grenzenlos. Das Maß helfender Hingabe an den Anderen und des teilnehmenden Gestaltens für den Anderen, das der Einzelne aufwendet, bleibt in letzter Konsequenz unabgrenzbar. Alles Tun und Lassen auch im Kleinen hat eine unabsehbare Auswirkung und Reichweite hinsichtlich seines engeren und weiteren Lebensumkreises.
„Gelassenheit“ statt Nachlässigkeit
In der Vielfalt der zum Teil auch widerstreitenden Anforderungen, denen sich der in Leitungsverantwortung Stehende häufig ausgesetzt sieht, fordert seinen aktiven Gestaltungswillen, sein entschlossenes In-Angriff-nehmen und Sich-durchsetzen-wollen besonders heraus. Dabei wird leicht übersehen, dass alles seine Zeit hat und braucht, dass jede Tätigkeit in einen größeren Geschehenszusammenhang eingebunden ist, der im Wenigsten von „uns“ abhängt. Systole und Diastole gehören zusammen – aktives Gestaltenwollen muss sich selbst begrenzen und Loslassenkönnen. Gelassenheit zu den Dingen und Menschen bedeutet, dass man sich gerade auch in kritischen Situationen, in denen einem Aufgaben und Anforderungen über den Kopf zu wachsen drohen, vom Eigenwillen befreit, um den Dingen und Abläufen den ihnen gemäße Zeit zukommen zu lassen, sich dem freien Walten der Lebenskräfte vertrauend zu überlassen.
Die Gelassenheit ist eine ursprünglich religiöse Tugend, durch die der Mensch alle Bedrohung und Anfechtung als etwas „Äußeres“ an sich herankommen lässt, weil er sich in einem tieferen Lebensgrund, von dem letztlich alles abhängt, geborgen weiß.16
Daher hat Gelassenheit nichts mit Nachlässigkeit, Säumigkeit oder Gleichgültigkeit zu tun. Der Gelassene ist weder passiv noch aktiv; er sucht vielmehr eine innere Freiheit zu wahren, die es ihm erlaubt, sich in Einklang zu setzen mit dem Geschehensganzen und zu dem, was „an der Zeit“ ist.
Die gelassene Haltung ist unerlässlich für ein gelingendes Leben, weil nur so im Blick auf Andere und Anderes ein hinnehmendes Tätigwerden, ein tätiges Lassen und Sich-einlassen möglich ist. Nur so ist ein Sich-offenhalten für unerwartete Möglichkeiten und unberechenbare Zeitigungen zu gewinnen und in Gelassenheit Einlass zu finden in ein tragendes größeres Lebensganzes.17
Die Gelassenheit ist die wohl wichtigste Tugend einer Personalführung: Weil nur Gelassenheit es verhindert, dass uns atmosphärische Schwankungen und Unbilden des Tagesgeschäfts aus der Bahn werfen und wir von Ärgernissen und Enttäuschungen korrumpiert werden. Der Gelassene bewahrt sich vielmehr die innere und äußere Offenheit, allem Geschehen und den in dieses eingebundenen Mitarbeitern die nötige Zeit zu lassen. Er vermag sich mitgestaltend wie vertrauend auf das ihm Begegnende einzulassen, weil er auf einem tieferen Boden steht, weil er das eigentlich Wesentliche im Blick behält und sich selbst bescheidet; weil er weiß, dass das Lebensgeschehen – wie gesagt – nur in einem sehr begrenzten Rahmen von ihm selbst abhängt, sondern er sich umgekehrt von diesem getragen weiß.
4. Einübung gelingenden Lebens
Alles ethische Handeln steht Albert Schweitzer zufolge im Spannungsverhältnis der „Ethik der Selbstvervollkommnung“ und der „Ethik der Hingebung“. Erst beide zusammen machen – wie bereits angesprochen – in ihrer wechselseitigen Verwiesenheit aufeinander erst die „vollständige Ethik“ aus.18 Selbstvervollkommnung und Hingabe bilden – im Bild gesprochen – in ihrer Zusammengehörigkeit die beiden Brennpunkte einer Ellipse.
Schweitzers Ethikmodell ist grundlegend für jegliche Formen und Zusammenhänge des Menschseins, weil es den Horizont eröffnet, innerhalb dessen „der Mensch in das wahre Verhältnis zum Sein, das in ihm und außer ihm ist“, kommt. Als „Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“ muss der Mensch im privaten wie im beruflichen Lebensumkreis je eigens Orientierung darüber finden, in welchem Maß er leidend und tätig, selbsterhaltend und hingebend sein Verhältnis zu anderem Leben gestaltet. Wie dieses Verhältnis auszusehen hat, kann nicht durch kasuistische Handlungsanweisungen oder Tugendkataloge vorbestimmt werden. Die Ethik ist nach Schweitzer kein „Park“ mit wohlgeordneten Plätzen und Wegen, die jedem zeigen, wo es langgeht. Sie ist vielmehr „Wildnis“, in der jeder seinen eigenen Weg erst bahnen und suchen muss. Für das „Labyrinth des Lebens“, als welches sich auch überschaubare Einrichtungen wie Studienseminare mit ihren Mitarbeitern und vielfältigen Außenkontakten mitunter darstellen, bedeutet dies, nicht auf Schritt und Tritt Geund Verbotsschilder und Wegweiser aufzustellen, auch wenn diese im begrenzten Rahmen durchaus dienlich sind. Vielmehr kommt es darauf an, dass jeder in eigener (grenzenloser) Verantwortung von Situation zu Situation stets neu entscheidet, inwieweit er sich in Selbstvervollkommnung übt oder sich in selbstloser Hingabe an Andere und für Andere verausgabt. Für solches Entscheiden bietet – so darf mit Schweitzer behauptet werden – die „Ehrfurcht vor dem Leben“ einen universell tragfähigen „Kompass“ und zwar nicht nur für den individuellen Privatbereich, sondern auch für das Wirken im institutionellen Zusammenhang des Studienseminars oder anderer gesellschaftlicher Einrichtungen.

Mit Schweitzers Ehrfurchtsethik ist zugleich ein Wertehorizont aufgespannt, innerhalb dessen jeder, zumal derjenige mit Personalverantwortung, die bisher betrachteten Wertorientierungen wie der Wahrheits- und Sinnfindung, des Verstehens und der Verständigung, der Begegnung auf Augenhöhe oder der Gelassenheit aktualisieren sollte. Mit diesem Wertehorizont ist zugleich die Bedingung der Möglichkeit für ein gelingendes Leben aufgetan, zu dem das Studienseminar in der Heranbildung des Lehrernachwuchses und der Gestaltung von Schule als Keimzelle gesellschaftlicher Kontinuität und Erneuerung beiträgt.
Hierzu noch ein abschließender Gedanke: Wenn es in Schule und Gesellschaft in erster Linie um „Einübung“ gelingenden Lebens geht, soll damit gesagt sein, dass das „Leben“ immer nur in Ansätzen, partiell oder temporär gelingt, aber niemals im abschließenden Sinne und in all seinen Facetten „gelingen“ kann. So konnte auch Rilke im Bezug auf die „Liebe“ sagen, was zugleich auch für das „Leben“ gilt: „Gekonnt hat’s keiner!“
Dies bedeutet auf der einen Seite, dass wir in der Grundspannung eines „Immer- besser-können-wollens“ leben und auch das Joch eines „Immer-besserkönnen- müssens“ spüren, das uns täglich neu antreibt. Andererseits hat es etwas Entlastendes: Angesichts der Unabschließbarkeit und Unvollkommenheit des Lebens können wir auch die Gelassenheit aufbringen, uns von einem Perfektionismusanspruch zu lösen, der leicht in Unduldsamkeit oder gar Fanatismus umschlagen kann. Alles Leben ist immer ein mehr oder weniger Gelingendes, all unser Tun und Gestalten ist und bleibt letztlich Improvisation. Wer für sich und seine Mitarbeiter die Fundamentalprämisse des „Imperfektum Mensch“ akzeptiert, wird nicht an deren Unzulänglichkeiten oder den eigenen verzweifeln. Er wird diese annehmen können, weil er sein ganzes Vertrauen auf die Gestaltungsmächtigkeit und Entwicklungsfähigkeit des Lebens in sich und außer sich im Sinne einer Humanisierung, die der Ehrfurcht vor dem Leben entspricht, setzen kann. So sollte auch die tägliche Berufsausübung auf ein immer besser gelingendes kollegiales Zusammenwirken ausgehen, das sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen lässt. In diesem Sinne ist auch das Wort von St.-Exupéry zu verstehen, mit dem ich meine Ausführungen beschließe:
„Du schreibst ein Gedicht, und hernach willst du es verbessern! Ist Schreiben denn etwas anderes als Verbessern! Ist Bildhauern etwas anderes als Verbessern! Hast Du gesehen, wie der Lehm geknetet wird? Aus Verbesserung über Verbesserung geht das Gesicht hervor, und schon der erste Daumendruck war eine Verbesserung des Lehmblocks. Wenn ich meine Stadt gründe, verbessere ich den Sand. Dann verbessere ich meine Stadt. Und durch Verbesserung über Verbesserung schreite ich Gott entgegen.“19
- Magazin Süddeutsche Zeitung 3.9.2010, S. 10.
- Römische Schulszene, Fundstätte Neumagen/Dhron, ca. 180 n.Chr..
- Otto Friedrich Bollnow: Maß und Vermessenheit des Menschen. Philosophische Aufsätze. Göttingen 1962, S. 31
- Dirk Meissner in: Süddeutsche Zeitung 11./12.09.2010, S. 23.
- Zit. n. Otto Friedrich Bollnow: Philosophie der Erkenntnis. Das Vorverständnis und die Erfahrung des Neuen. Stuttgart u.a. 1970, S. 133.
- Albert Schweitzer: Aus meiner Kindheit und Jugendzeit. München 1985, S. 57f.
- Albert Schweitzer: Kulturphilosophie. München 2007, S. 308.
- Albert Schweitzer: Kulturphilosophie, S. 298.
- Otto Friedrich Bollnow: Studien zur Hermeneutik. Bd I: Zur Philosophie der Geisteswissenschaften. Freiburg/München 1982, 240ff.
- Otto Friedrich Bollnow: Zwischen Philosophie und Pädagogik. Vorträge und Aufsätze. Aachen 1988, S. S.65f.
- Antoine de Saint-Exupéry: Der Kleine Prinz. Düsseldorf, 7. Aufl. 1999, S. 96.
- Vgl. Martin Buber: Ich und Du. Heidelberg 11. Aufl. 1983, S. 44.
- Ebd., S. 18.
- Ebd., S. 23.
- Zur anthropologischen Bedeutsamkeit des Vertrauens vgl. Gottfried Schüz: Lebensganzheit und Wesensoffenheit des Menschen. Otto Friedrich Bollnows hermeneutische Anthropologie. Würzburg 2001, S. 164-191.
- Vgl. Otto Friedrich Bollnow: Wesen und Wandel der Tugenden. Frankfurt/M u.a. 1952, S.120ff.
- Vgl. Gottfried Schüz: Lebensganzheit und Wesensoffenheit des Menschen, S. 265ff.
- Albert Schweitzer: Kulturphilosophie, S. 298.
- Antoine de Saint-Exupéry: Die Stadt in der Wüste (Citadelle). Frankfurt/M., Berlin 1989, S.282.