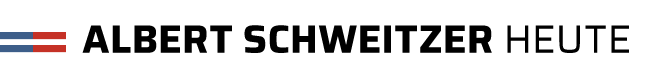Von Roland Wolf
Sie heißt Adrienne Mengue, ist etwa 60 Jahre alt und kommt aus dem Dorf Benguié, etwa 40 Kilometer von Lambarene entfernt. Eines Tages wird sie, im Koma liegend, als Notfall ins Albert-Schweitzer-Spital eingeliefert. Wohl nach einem Anfall war die Epileptikerin ins Feuer gefallen und hatte sich schwere Verbrennungen am linken Arm und der Brust zugezogen.
Sechs Wochen liegt die komatöse Patientin auf der Notfallstation, umsorgt von ihrem Mann, der Tag und Nacht an ihrem Krankenbett ausharrt; die drei anderen Frauen des polygamen Ehemanns mögen sie nicht und lassen sich nur ab und zu blicken. Ein Monitor überwacht Blutdruck und Herzfrequenz, sie wird intravenös ernährt, muss aber nicht beatmet werden. Das Pflegepersonal kümmert sich um sie, wechselt täglich die Verbände. Doch die ärztliche Versorgung ist problematisch, denn in der Notfallstation gibt es keinen dauerhaften Arzt, und deshalb findet keine regelmäßige ärztliche Visite statt.
Außerdem sind sich Internisten und Chirurgen nicht ganz einig. Für die Internisten ist die Patientin ein Fall für die Chirurgie, die Chirurgen verweisen dagegen auf die Epilepsie und den komatösen Zustand, die der Inneren Medizin zugerechnet werden müssten. Mehrmals entscheiden sich die Ärzte gegen eine Operation. Und auch die Anästhesisten äußern Bedenken wegen des Zustandes der Patientin. Sogar die Angst vor einer eventuellen Klage der Angehörigen nach einem misslungenen Eingriff wird vorgebracht. Eine, die diese Situation nicht ruhen lässt, ist die deutsche Medizinstudentin Lea, die in der Chirurgie einen Teil ihres praktischen Jahres ableistet. Sie sorgt durch ihre Hartnäckigkeit zunächst dafür, dass sie unter Aufsicht eines Chirurgen statt des peripheren einen zentralen Zugang legen kann, etwas, das in Lambarene normalerweise nicht praktiziert wird. Das benötigte Material hatte der Chirurg glücklicherweise aus Libreville mitgebracht. Lea kümmert sich täglich um die Frau, gewinnt den Chefkrankenpfleger als Unterstützung. Doch die Zeit verrinnt. Der Arm der Patientin verfault zusehends bis hin zur kompletten Skelettierung. Der Gestank ist für das Pflegepersonal kaum auszuhalten, die Schwestern wollen die Verbände nicht mehr wechseln.
Lea lässt nicht locker, wendet sich an den Chefarzt. Der weist darauf hin, dass die Patientin bereits jetzt dem Spital hohe Kosten verursacht habe: sie verfüge über keine Krankenversicherung, und die Familie könne die Behandlungskosten nicht aufbringen, geschweige denn die Kosten für eine Operation. Daneben gibt es Stimmen, die die Frau als hoffnungslosen Fall ansehen und raten, sie sterben zu lassen. Wäre es ihnen vielleicht sogar lieber, solche Fälle abzuweisen, um die Zahl der Todesfälle klein zu halten und den Ruf des Arztes nicht zu schädigen?
Mit der Ankunft eines neuen Chirurgen aus Libreville, der ein Jahr seiner Facharztausbildung in Lambarene ableisten will, ändert sich die Lage schlagartig. Ihm gelingt es, seine Kollegen von der Notwendigkeit einer Operation, d. h. die Amputation des Armes, zu überzeugen. Der Zustand der Patientin hat sich auch nach zwei Bluttransfusionen deutlich gebessert, sie ist zusehends aus dem Koma erwacht. Nun trauen sich auch die Anästhesiepfleger zu, die Patientin zu narkotisieren.
Jetzt ist noch ein letztes Problem zu lösen: das der Blutspende. Wenn eine Bluttransfusion notwendig ist, müssen die Angehörigen des Patienten das notwendige Blut spenden oder beschaffen. Das ist nicht immer einfach und obendrein teuer, denn für jeden fertigen, d. h. getesteten und für gut befundenen Blutbeutel müssen 20.000 Francs, 30 Euro, bezahlt werden. Hat der Patient keine Angehörigen, die Blut spenden können, muss das Blut aus der Blutbank des Spitals entnommen werden, und dann kostet der Beutel sogar 50.000 Francs, etwa 75 Euro. Unerschwinglich für die Familie von Adrienne Mengue.
In dieser Situation kommt der Verfasser dieser Zeilen ins Spiel. Schon seit längerer Zeit steht er mit Lea in Verbindung, ist über den Fall informiert und zur Hilfe bereit. Wie schon öfter hat er bei seinem Aufenthalt in Lambarene Geldspenden aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis dabei, um schnelle und unbürokratische Hilfe leisten zu können. So stellt er sofort 300 Euro zur Verfügung, womit Blutbeutel, Infusionen und Schmerzmittel bezahlt werden. Nun steht der Operation nichts mehr im Wege.
Zur allgemeinen Freude verläuft die Amputation des Armes ohne Komplikationen. Die Nachwirkungen für die Patientin halten sich im normalen Rahmen, es kommt zu keiner Infektion. Zwei Wochen später verlässt sie das Albert-Schweitzer-Spital, um mit ihrem Mann in ihr Dorf zurückzukehren. Die Krankenhausrechnung übernimmt der Deutsche Hilfsverein, der für solche Fälle einen Notfonds eingerichtet und mit jährlich 10.000 Euro ausgestattet hat: Hilfe für die Ärmsten, die Notleidenden – ganz im Sinne Schweitzers.