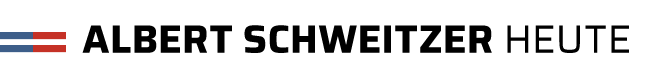Von Manfred Keller
So, wie ihn das Foto auf dem Flyer der Ahauser Veranstaltungsreihe zeigt, so kannten wir zu meiner Schulzeit Albert Schweitzer: der buschige Schnurrbart, das kräftige, bisweilen widerspenstige Haupthaar, der Stehkragen mit Fliege zum weißen Hemd. Sein Blick – hier nachdenklich, auf anderen ähnlichen Porträts auch mit einem weisen, leicht verschmitzten Lächeln. Die meisten dieser Fotos stammen aus den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als Albert Schweitzer den Höhepunkt seiner Popularität erreichte. Inzwischen ist er fast vergessen.
Bekannt geworden war er als „Urwalddoktor von Lambarene“, der in Gabun in Zentralafrika ein Krankenhaus mit Leprastation aufgebaut hatte. Er hat es erhalten, erneuert und ausgebaut trotz der Wirren zweier Weltkriege – stets selbst finanziert durch Vorträge und Konzerte, zu denen er als Philosoph und Theologe, als Bach-Kenner und Orgelspieler weltweit eingeladen wurde. Durch die Vortrags- und Konzertreisen bildet sich ein internationaler Sponsorenkreis. Seine Spenden tragen zum Unterhalt von Lambarene ebenso bei wie die Preisgelder, die Albert Schweitzer durch hohe und höchste Auszeichnungen zufließen. 1951 erhält er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, 1953 den Friedensnobelpreis.
Publizistisch beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg die Glorifizierung Albert Schweitzers. Amerikanische Medien feiern ihn überschwänglich als den größten Entwicklungshelfer der Welt, als „Man of God“, als den „dreizehnten Jünger Jesu“ oder auch – in Anspielung auf die Dächer des Lepradorfes von Lambarene – als „Mister Wellblech“. In dieser etwas flapsigen Bezeichnung deuten sich schon erste Nadelstiche an. Denn auf jede Glorifizierung eines Menschen in den Medien folgt irgendwann Kritik und Widerspruch, nicht selten sogar der Versuch einer publizistischen Demontage. So auch im Falle Albert Schweitzers.
Die Kritik der Journalisten setzt an bei Schweitzers Einstellung zur Kolonialpolitik und bei seinem Umgang mit den schwarzen Patienten und Mitarbeitern. Ohne auf diese Probleme hier gründlich eingehen zu können, ist schlicht festzustellen: Schweitzer lehnte politische Unabhängigkeitsbewegungen der Schwarzen ab und hielt fest an einer kulturellen Überlegenheit der Weißen: „Ich bin euer Bruder, aber euer älterer Brüder“, so sagte er gegenüber den eingeborenen Patienten und Mitarbeitern. Und, ernsthaft schlimm: „Gegenüber Afrikanern rutschte ihm auch schon mal die Hand aus“, wie in einer neueren Biographie berichtet wird.
All das kann und muss uns nicht gefallen. Aber es kann und soll uns daran erinnern, dass auch Albert Schweitzer ein Mensch mit Schwächen und ein Kind seiner Zeit war. – Jeder Mensch ist ein Kind seiner Zeit. Wir alle sind es. Wir sind Kinder der Familie, in die wir hineingeboren sind; Kinder des Ortes, an dem wir aufgewachsen sind; Kinder der Zeit, die unsere Vorstellungswelt und unser Denken geprägt hat.
Für Albert Schweitzer gilt diese Prägung durch Familie, Ort und Zeit in besonderem Maße. Am 14. Januar 1875 wird er in Kaysersberg im Oberelsass als zweites Kind einer Pfarrfamilie geboren. Eine Freundin der Familie beschreibt die Mutter als „klug, aber etwas streng“, den Vater als „warmherzig und behaglich.“ Die Vorfahren beider Eltern waren Pfarrer, Lehrer, Organisten und Orgelbauer. Wenige Monate nach Alberts Geburt übernimmt der Vater eine Diasporapfarrstelle in Günsbach in der Nähe von Colmar. „Dort“, so schreibt Schweitzer später in seinen Jugenderinnerungen, „verlebte ich mit meinen drei Schwestern und meinem Bruder eine sehr glückliche Jugend.“
Bei seiner Geburt gehört das Elsass gerade erst seit vier Jahren wieder zum Deutschen Reich. Und 1918, nach dem für Deutschland verlorenen Krieg, muss es wieder an Frankreich zurückgegeben werden.
Albert wächst also in zwei Kulturkreisen auf, dem deutschen und dem französischen, natürlich zweisprachig, und er lebt wie selbstverständlich als Protestant innerhalb einer katholischen Mehrheit. Ein solcher Rahmen weitet den geistigen Horizont und führt zu einer Liberalität als Grundhaltung, die nichts mit Beliebigkeit zu tun hat.
Kulturelle Ereignisse sind auf dem Dorf in Günsbach allerdings nur spärlich gesät. So freut sich der kleine Albert die Woche über auf den Sonntagsgottesdienst. Ihn begeistert die Orgelmusik und er ist gespannt auf die biblischen Geschichten, die sein Vater erzählt und auslegt. Nicht zu vergessen die Missionsgottesdienste, die zu jener Zeit verbreitet waren. Auf sie führt Albert Schweitzer bereits in den Kindheitserinnerungen sein Interesse an der Mission zurück. Ganz ohne Frage haben seine Liebe zur Orgel und zur Theologie ihre Wurzeln in Günsbach.
Es ist also kein Zufall, dass der junge Albert nach dem Abitur 1893 – mit 18 Jahren – die Universität Straßburg bezieht, und es verwundert auch nicht, welche Fächer er dort studiert. In den Lebenserinnerungen heißt es: „Kühn nahm ich mir vor, Theologie, Philosophie und Musik miteinander zu betreiben. Meine gute Gesundheit, die mir die erforderliche Nachtarbeit erlaubte, machte es mir möglich, diesen Vorsatz durchzuführen. Aber es war doch viel schwieriger, als ich gedacht hatte.“ Dank seiner großen, vielseitigen Begabungen und einer schier unglaublichen Arbeitskraft zieht er alle drei Studiengänge nicht nur parallel durch, sondern beendet zwei davon auch mit glänzenden akademischen Abschlüssen: 1899 promoviert er zum Doktor der Philosophie, ein Jahr später folgt der theologische Doktor und nach weiteren zwei Jahren, am 1. März 1902, hält der gerade 27jährige seine Antrittsvorlesung als Privatdozent an der Theologischen Fakultät zu Straßburg.
Der Schlüssel zu diesem wissenschaftlichen Erfolg liegt darin, dass Schweitzer sich schon früh auf bestimmte Themen konzentriert. Sein zentrales Thema ist die Gestalt Jesu von Nazareth und die Erforschung seines Lebens. Das Neue Testament zeigt uns ein Bild von Jesus Christus, das der Apostel Paulus und die Evangelisten (in dieser Reihenfolge!) im Laufe mehrerer Jahrzehnte entwickelt und ausgemalt haben. Die antike Kirchengeschichte ergänzt und verfestigt dann das Bild des „dogmatischen Christus“.
In der Neuzeit möchte die Theologie zurück zum „historischen Jesus“. Wie ein Restaurator behutsam eine Übermalung nach der anderen entfernt, um das ursprüngliche Bild freizulegen, so suchten die Theologen des 18. und 19. Jahrhunderts eine Überlieferungsschicht nach der andern abzutragen, um unter der kirchlichen Übermalung wieder den ursprünglichen Jesus zu entdecken.
In seinem theologischen Hauptwerk „Geschichte der Leben-Jesu-Forschung“ zeigt Albert Schweitzer, dass dieses ganze Unternehmen gescheitert ist, ja, scheitern musste. Es musste scheitern, weil das Neue Testament gar kein „Leben Jesu“ bieten will, sondern Jesus Christus in Wort und Tat als Gottes Zuwendung zu Menschen aller Zeiten – auch zu uns – verkündigt. Die Leben-Jesu-Forschung ist aber auch deshalb gescheitert, weil jeder Forscher eine eigene Rekonstruktion des „historischen Jesus“ versuchte, indem er in Jesus die Züge des eigenen Ideals hineinlas. Schweitzer zeigt, dass so eine Vielzahl verschiedenartiger Jesusbilder entstand, die aber bei näherem Hinsehen alle von dem fortschrittsgläubigen humanistischen Geschichtsbild der eigenen Zeit geprägt sind. Danach ist die Geschichte ein Prozess, in dem die Menschheit sich durch die Kräfte des Guten, Wahren und Schönen Stufe um Stufe aus dem Naturzustand zur Kultur emporarbeitet. Das Ziel dieser Entwicklung ist das Reich Gottes, das man sich als einen ethischen Idealzustand vorstellt, als „sittliches Reich“ oder als „sittliche Vollendung der Menschheit“. Der sog. „historische Jesus“ spielt in diesem Prozess eine wichtige Rolle. Er hatte – so sah man es – mit seinem Vorbild und mit seiner Predigt – als Künder wahrer Menschlichkeit und eines vernünftigen Gottesglaubens – den Grund dieses „sittlichen Reiches“ gelegt, das nun im geschichtlichen Fortschritt von Kirche und Staat – am besten durch den „christlichen Staat“ – zu pflegen und zu verwirklichen sei.
So also sah die theologische Großwetterlage aus, die Albert Schweitzer vorfand. Beim Studium des Neuen Testaments entdeckt der junge Theologe nun, dass all diese verharmlosten Jesus-Bilder des 18. und 19. Jahrhunderts moderne Kopfgeburten sind. Er erkennt, dass Jesus nicht im Rahmen des neuzeitlichen idealistischen Denkens, sondern im Zusammenhang des jüdischen Denkens seiner Zeit gesehen werden muss.
Insbesondere das Matthäusevangelium vermittelt ihm ein neues, teilweise befremdliches Bild von Jesus. Schweitzer studiert die große Aussendungsrede im 9. und 10. Kapitel dieses Evangeliums. Hier zeigt sich, dass Jesus in seinem Denken von einem Weltbild bestimmt war, das nicht mehr das unsere ist. Jesus lebte in der Vorstellung von Dämonen und Engeln, von Satan und Hölle, von Weltuntergang und einem Endgericht, das mit dem Kommen des „Menschensohnes“, einer messianischen Gestalt, anbricht. Das alles sind Vorstellungen, die uns fremd geworden sind, mit denen wir uns auch nicht belasten müssen. Zwar erleben auch wir in unserer Welt einerseits gute, lebensfördernde Kräfte und andererseits böse und zerstörerische Mächte. Aber wir fassen sie nicht mehr in die Bilderwelt des jüdischen Denkens der Zeit Jesu, das wir heute als „apokalyptisches“ Denken oder „eschatologisches“, d.h. endzeitliches Denken bezeichnen.
Wegen der knappen Zeit, die uns für diese Einführung in das theologische Denken Schweitzers zur Verfügung steht können wir hier nicht weiter auf die Aussendungsrede und auf die Gedankenwelt Jesu eingehen. Aber schon das Wenige, das uns Schweitzer bisher deutlich gemacht hat, zeigt, wie befreiend sein Ansatz auch für unser heutiges Denken und Glauben sein kann. Albert Schweitzer möchte den Glauben von dogmatischen Formeln befreien und auf das gelebte Gottvertrauen zurückführen: auf ein persönliches Gottesverhältnis und eine lebendige Frömmigkeit, die Jesus als dem Herrn des eigenen Lebens folgt. Und dafür darf die Gestalt Jesu in all ihrer Eigenart und Fremdheit stehen bleiben. Denn entscheidend ist für Schweitzer nicht die Gedankenwelt Jesu, entscheidend sind der Geist Jesu und sein Wille.
Für Albert Schweitzer ist Jesus also keineswegs nur ein ethisches Vorbild. In der Schlussbetrachtung seiner großen „Geschichte der Leben-Jesu-Forschung“ zeigt er, dass es vielmehr um Gemeinschaft mit Jesus geht, mehr noch: um ein Leben mit Jesus und ein Sein in Jesus – auch heute, auch bei uns. Wörtlich heißt es da: „Im letzten Grund ist unser Verhältnis zu Jesus mystischer Art. Keine Persönlichkeit der Vergangenheit kann durch geschichtliche Betrachtung oder durch Erwägungen über ihre Bedeutung lebendig in die Gegenwart hineingestellt werden. Eine Beziehung zu ihr gewinnen wir erst, wenn wir in der Erkenntnis eines gemeinsamen Wollens mit ihr zusammengeführt werden und uns selbst in ihr wiederfinden. Nur so schafft Jesus auch Gemeinschaft unter uns.“ Ganz in diesem Sinne endet das Buch mit den schönen Sätzen: „Als ein Unbekannter und Namenloser kommt Jesus zu uns, wie er am Gestade des Sees an jene Männer herantrat, die nicht wussten, wer er war. Er sagt dasselbe Wort: Du aber folge mir nach! und stellt uns vor die Aufgaben, die er in unserer Zeit lösen muss. Er gebietet. Und denjenigen, die ihm gehorchen, Weisen und Unweisen, wird er sich offenbaren in dem, was sie in seiner Gemeinschaft an Frieden, Wirken, Kämpfen und Leiden erleben dürfen, und als ein unaussprechliches Geheimnis werden sie erfahren, wer er ist …“.
Diese eindrucksvollen Sätze sind zugleich das persönliche Glaubensbekenntnis Albert Schweitzers. Er schreibt sie 1905 im Alter von dreißig Jahren und löst sie ein in den folgenden sechzig Jahren seines langen, arbeitsreichen Lebens. Er versteht den Ruf Jesu als Ruf zu einem „unmittelbaren menschlichen Dienen“. Deshalb beginnt er 1905 das Medizinstudium und bewirbt sich nach dem Abschluss als Arzt bei der Kongo-Mission. 1912 heiratet Schweitzer seine langjährige Freundin Helene Bresslau. 1913 reist das Ehepaar Schweitzer nach Gabun aus, um sich in Lambarene dem praktischen Dienst am Nächsten in der Nachfolge Jesu zu widmen. Helene Schweitzer bekommt im tropischen Klima gesundheitliche Probleme. Immer wieder und im Alter immer länger muss sie nach Europa zurück, um sich zu regenerieren. Sie stirbt 1957 in Zürich. Albert Schweitzer hält sechs Jahrzehnte durch. Neben der schweren ärztlichen Tätigkeit im Urwald und dem kräftezehrenden Ausbau des Krankenhauses arbeitet er in den Abend- und Nachtstunden an theologischen und philosophischen Werken, vor allem an ethischen Schriften, in denen er seine berühmt gewordene Ethik der „Ehrfurcht vor dem Leben“ entwickelt. Mit den Voraussetzungen, Aspekten und Konsequenzen dieser Ethik werden wir uns im Anschluss an diese Einführung heute schwerpunktmäßig beschäftigen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg – veranlasst durch den Abwurf amerikanischer Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki vor jetzt genau 70 Jahren – erhebt Schweitzer seine Stimme gegen die atomare Bewaffnung. Er befürchtet eine Vernichtung allen Lebens auf der Erde: des Lebens der Menschen, der Tiere und der Pflanzen. Das öffentliche Eintreten gegen die atomare Bewaffnung muss Schweitzer mit massiver Kritik – vor allem aus den USA – bezahlen. Und mit einem empfindlichen Rückgang der Spenden, der zu finanziellen Problemen für Lambarene führt. Aber trotz aller Schwierigkeiten bleibt Albert Schweitzer dem Ruf Jesu, wie er ihn verstanden hat, bis an sein Lebensende treu – in seinem beruflichen Wirken und in seiner gesellschaftlichen Wirksamkeit. Er stirbt am 4. September 1965 und wird in Lambarene begraben.
Was können wir heute – 50 Jahre nach seinem Tod – aus der Lebensgeschichte Albert Schweitzers lernen und auf unser Leben beziehen? Diese Frage, auf die es unterschiedliche Antworten gibt, war die Leitfrage für die Veranstaltungen, die sich im September hier in Ahaus dem Vermächtnis Albert Schweitzers widmeten. Diese Frage sollte uns auch in den drei Arbeitsgruppen unseres Workshops leiten. In meiner kurzen theologischen Einführung wollte ich nur eine Antwort andeuten, die uns Albert Schweitzer als Christ gegeben hat. Es ist eine Antwort, die unseren Glauben und damit den Kern unserer Person betrifft. Sie lautet: Lasst uns – wie Albert Schweitzer – den Ruf Jesu hören und den Ort finden, an dem Gott uns haben will. Denn – noch einmal Originalton dieses überzeugten und überzeugenden Christen: „Ich habe immer klarer erkannt, dass die einzige Wahrheit und das einzige Glück darin besteht, unserem Herrn Jesus zu dienen, da, wo er uns nötig hat. … Alles Metaphysische der Religion kann ich als unerforschlich dahingestellt sein lassen. Der Jesus von Galiläa, der aus dem Matthäusevangelium zu mir spricht, lehrt mich die tiefe Menschlichkeit und Frömmigkeit und hilft mir, Menschen auf diesen Weg zu bringen.“
Anmerkung:
Der Vortrag wurde als Einführung in den Albert-Schweitzer-Workshop der Philosophiekurse Stufe 11 des Alexander-Hegius-Gymnasiums in Ahaus am 27. Oktober 2015 gehalten.