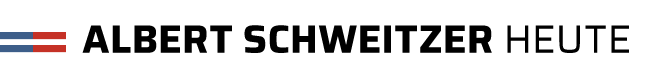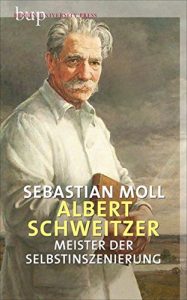Rezension von Gottfried Schüz
Zu Sebastian Moll: Albert Schweitzer – Meister der Selbstinszenierung.
Weder der ausführliche Rekurs auf vielfältige Sekundärquellen noch der eloquente Stil können darüber hinwegtäuschen, dass dieses Buch mehr über Sebastian Moll als über Albert Schweitzer zutage fördert.
Schweitzer hat in allem, was er schrieb und tat, aus „innerer Notwendigkeit“ und uneigennützig zum Wohl seiner Mitmenschen gehandelt. Dies lässt sich vielfältig und zweifelsfrei belegen. Ihm das Etikett eines „Meisters der Selbstinszenierung“ anzuhängen, ist bei Kenntnis seiner in vielen Büchern, Aufsätzen und Briefen dokumentierten Lebenshaltung völlig abwegig. Aber auch bei einem nicht einschlägig vorinformierten Leser kann Molls These bei kritischer Analyse seiner fadenscheinigen Argumentationsweise nicht verfangen.
Molls erschreckend naives Verständnis von „historischer Realität“ und das Fehlen an selbstkritischem Umgang mit den eigenen Mutmaßungen kennzeichnen dieses Buch. Ein Beispiel: Die Tatsache, dass Schweitzer insgesamt fünf autobiografische Schriften verfasste, nimmt er als „Beweis“ für Unbescheidenheit und selbstdarstellerische Ambitionen. Dass Schweitzer seine Autobiografien allesamt auf nachdrückliche Aufforderung von außen verfasste, weil an seinem Lebenswerk ein hohes öffentliches Interesse bestand, ficht Moll in seiner Polemik nicht an.
Insbesondere seine vergleichende Auseinandersetzung mit Schweitzers Autobiografie „Aus meiner Kindheit und Jugendzeit“ und der aufgrund einer Gesprächsaufzeichnung von seinem Freund Oskar Pfister verfassten Biografie fördert kaum „Historisches“ dafür aber umso mehr Unterstellungen und Mutmaßungen des Sebastian Moll zutage. Er behauptet eine Reihe von „inhaltlichen Änderungen“, die Schweitzer gegenüber dem Text Pfisters vorgenommen habe. Neben dem Perspektivenwechsel (Pfister schreibt „über Schweitzer“, Schweitzer hingegen erzählt „von sich“) nennt er dabei tatsächlich nur einen Punkt, die schulischen Leistungen des Albert betreffend: Während Pfister ausführlich das Bild eines hochbegabten Knaben zeichne, der „viel zu sehr Träumer (war), als dass er den Worten des Lehrers hätte folgen können“. Andererseits sei er wegen seiner Belesenheit seiner Klasse weit voraus gewesen und habe sich deshalb in der Schule gelangweilt. Schweitzer hingegen hatte von den Ausführungen Pfisters, die sich über eine Seite erstrecken, zu diesem Punkt lediglich beibehalten: „Im übrigen war ich ein stiller und verträumter Schüler, der das Lesen und Schreiben nicht ohne Mühe erlernte“. Moll bescheinigt den Ausführungen Pfisters „historische Korrektheit“, während er Schweitzers stark verkürzende Version als „Fälschung“ zum Zwecke der Selbstinszenierung abtut. Wer beide Texte vergleicht, kann eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass Schweitzer im Gegenteil bemüht ist, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, ohne zu den Ausführungen Pfisters im Widerspruch zu stehen.
Moll hingegen konstruiert nicht nur einen Gegensatz zwischen „wahr“ und „falsch“, sondern versteigt sich gar zu der abenteuerlichen Schlussfolgerung, dass Schweitzer sich deshalb für ein „understatement“ entschieden habe, um nicht als „hochbegabter Überflieger“ dazustehen, der „mit einer gewissen Überlegenheit auf seine Mitschüler herabblickt“ (S. 34). Wenn es Schweitzer darum gegangen wäre: warum hat er dann die Aussage laut Pfister, „alle (Mitschüler) hatten den jungen Schweitzer lieb“, nicht übernommen? Wäre dies nicht eine wunderbare Gelegenheit gewesen, einem Eindruck, er sei ein arroganter Überflieger gewesen, entgegenzuwirken? Aber Moll, der den unhaltbaren Historikeranspruch erhebt, „die Dinge so darzustellen, wie sie wirklich gewesen sind“ (S. 37), zieht es vor, eigene Unterstellungen und Spekulationen als „historische Tatsachen“ auszugeben.
Der zweite von Moll aufs „Korn“ genommene Punkt erweist sich ebenfalls als bloßes Scheingefecht: Man fragt sich, wo in seiner Feststellung, Schweitzer habe „ohne Zweifel eine pädagogische Absicht verfolgt“ (S. 37), der historische Erkenntniszugewinn liegt. Schweitzer selbst betont seine pädagogische Absicht in besagter Autobiografie. Er begründete gegenüber Pfister einleuchtend, dass er deshalb „etwas ganz Neues“, von dessen Manuskript Abweichendes, geschrieben habe, weil er „etwas so Intimes eigentlich als Selbsterzähltes“ für Kinder und mit einem „moralischen Schluss“ versehen darstellen wollte. Wer Pfisters Text (ca. 11 S.) mit Schweitzers Autobiografie (60 S.) vergleicht, dem springt buchstäblich ins Auge, dass Pfisters Text sowohl inhaltlich als auch in der Diktion Kinder oder Jugendliche wenig anspricht. Der deutlich gewachsene Umfang erklärt sich dadurch, dass Schweitzer in seine Schrift zahlreiche Anekdoten und Kindheitserlebnisse aufgenommen hat, die im Gespräch mit Pfister und damit in dessen Biografie unerwähnt geblieben waren. Warum all dies weniger glaubwürdig sein soll, als das, was Schweitzer zuvor seinem Freund Pfister berichtet hatte, bleibt unerfindlich. Es ist im Gegenteil nur zu verständlich, dass Schweitzer Vieles, was er Pfister gegenüber nur sehr allgemein formuliert hatte, in zahlreichen Beispielen aus seiner Kindheit konkretisiert und verlebendigt, um so Kinder anzusprechen.
Dass auch Pfister das so gesehen hat und Schweitzers Neufassung keineswegs als Geschichtsklitterung empfand, lässt sich mit seinem Brief an Schweitzer vom 3.10.1922 klar belegen. Dort schreibt Pfister: „Jetzt bekommt das i das rechte Tüpfelchen! Du hast da eine prachtvolle Jugend- & Volksschrift geschrieben und ein wackeres Stück innere Mission betrieben. Auch die Lehrer werden jubeln, wenn sie Deine Lebensbeschreibung empfangen. … Meine ungenügende Arbeit hat Dich zu einer vollwertigen veranlasst.“ (Zager, Briefwechsel, S. 576) Dieses wichtige Dokument bleibt jedoch in Molls „historischer“ Darstellung gänzlich unerwähnt. Es hätte seine Manipulationsthese durchkreuzt.
Auch Schweitzers Abfassung einer auf drei große Bände angelegte Kulturphilosophie mit der umfassenden Neubegründung einer universellen Ethik, die alles Leben umgreift, kann in ihrer Einzigartigkeit und Originalität auch durch Molls Pseudokritik nicht geschmälert werden. Auch hierzu ein Beispiel für Molls kurzschlüssige Argumentationsweise: Schweitzers Bericht über seine Entdeckung der „Ehrfurcht vor dem Leben“ meint Moll als Mythos abtun zu können: „(Es) entspricht die mystische Erfahrung auf dem Fluss Ogowe im September 1915, bei der Schweitzer den Begriff Ehrfurcht vor dem Leben erstmals vor Augen gesehen haben will, schon allein deshalb nicht den historischen Tatsachen, da er ihn bereits im Jahre 1912 verwendet hatte.“ Moll blendet den eigentlichen Kontext dieser Entdeckung aus. Es ist sehr wohl beides vereinbar, wenn man bedenkt, dass Schweitzer im Gegensatz zu 1912 die „Ehrfurcht vor dem Leben“ auf dem Ogowe erstmals als Schlüsselbegriff für die Begründung einer universellen Ethik begriffen und in seiner fundamentalen Bedeutung erkannt hatte. Dies führte Schweitzer in seiner Autobiografie selbst aus, was aber Moll nicht erwähnt – soviel zu den von Moll beschworenen „historischen Tatsachen“.
Was Moll mit diesen und anderen vermeintlich „historische Wahrheiten“ in seinem Buch anführt, ist kein Beleg für einen „neuen Schweitzer“, sondern für den wissenschaftlich fragwürdigen Umgang des Herrn Moll mit historischen Texten.
Ein warnendes Beispiel für jeden Bachelor-Aspiranten, wie man es nicht machen sollte.
Moll behauptet, dass alles, was aus autobiografischer Feder stammt, zweifelhaft und unter dem Generalverdacht des Unwahrhaftigen stehe, während das, was anderen Quellen entstammt, „historische Realität“ wiedergebe. Wie kann ein Autor, der noch heute dem naiven Geschichtsverständnis des 19. Jahrhunderts huldigt, erwarten, wissenschaftlich ernst genommen zu werden? Für die Geschichtswissenschaft und allgemein für jede Textkritik gehört es spätestens seit Dilthey und Gadamer zum Standardwissen, dass Quellentexte, ob autobiografisch oder nicht, an die subjektive Wertungs- und Sichtweise seines Verfassers unhintergehbar gebunden sind und niemals den Anspruch erheben können, „historische Realität“ objektiv abzubilden.
Insofern kann man Moll „subjektive Befangenheit“ nicht vorhalten. Allerdings muss man ihm massiv vorwerfen, dass seine mit eigenen Wertungen, Vorannahmen und Projektionen durchsetzte Darstellung keinen beweiskräftigen oder auch nur nachvollziehbaren Rückhalt in den herangezogenen Quellen findet.